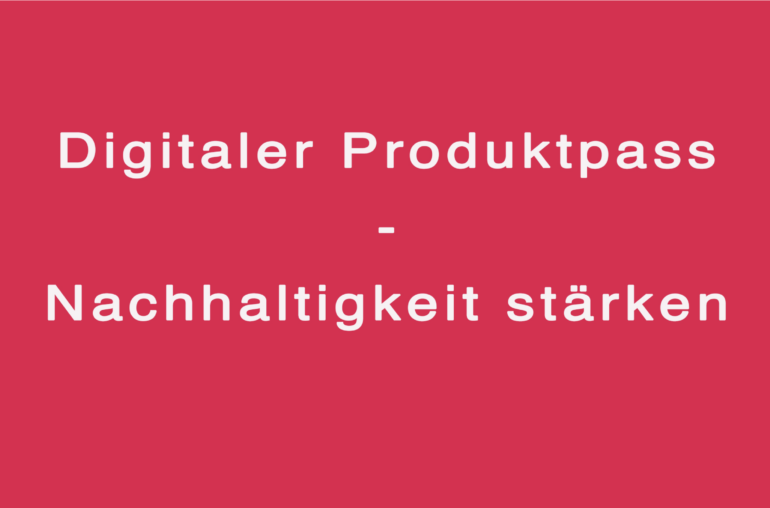Auf dem Weg zur Klimaneutralität haben sich die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) zum Ziel gesetzt, durch Produkte und Dienstleistungen verursachte Umweltwirkungen in den Beschaffungsprozess zu integrieren.
Ein Beitrag von Sven Schirmer
Als Unternehmen steht man aktuell den verschiedensten Herausforderungen gegenüber. Nachhaltigkeit ist ein Wirtschaftsfaktor. Die Fragen werden gestellt: Was muss man tun, was soll man tun? Wie bereite ich mich auf die Anforderungen meiner Kunden und Auftraggeber vor? Wie kann ich mein Produkt- und Dienstleistungsportfolio verändern, damit es als Nachhaltig, aber nicht als Greenwashing bezeichnet wird?
Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sind der Mobilitätsanbieter in Österreich. Der Strategische Konzerneinkauf der Holding steuert u.a. die jährlich bis zu 4 Mrd. Euro an Investitionen des Gesamtkonzerns und dies besonders nachhaltig. 2020 wurde dort eine Erweiterung des bestehenden TCO Modells (Total Cost of Ownership) in Angriff genommen. Neben den reinen Einmalkosten, den Errichtungs- als auch laufenden Kosten, wurde es um die durch Umweltwirkungen verursachten Kosten erweitert. Basierend auf den Europäischen Forderungen und weltweiten Standards galt es, ein Modell zu entwickeln, welches den jetzigen als auch zukünftigen Anforderungen gewachsen ist.
Ausschlaggebend sind hier zuerst der sogenannte europäische Green Deal, welcher ein klimaneutrales Europa bis 2050 fordert, zu nennen, sowie als Zweites, das Green House Gas Protocol, in welchem die weltweit anerkannteste Methodik beschrieben wird, um Klimaauswirkungen zu berechnen.
Eine Herausforderung für die ÖBB war es, die Anwendbarkeit für alle Warengruppen sicher- zustellen. Ob es um den Kauf von Büroklammern oder die Errichtung eines Tunnels geht, jedes Beschaffungsvorhaben sollte nutzerfreundlich durchführbar sein. Der Aufwand auf Auftraggeber- als auch -nehmerseite, sollte überschaubar bleiben. Dies hat erfreulicherweise den Effekt, dass auch KMUs von dem Modell profitieren können, denn es wurde auch für deren Anwendbarkeit erstellt.
Alle denkbaren und bekannten Einflussfaktoren wurden in der Modellentwicklung bereits von Anfang an berücksichtigt, um ein für alle nutzbares ökologisches Bewertungsmodell zu entwickeln.
Das TCO CO2 Modell
Im Unterschied zur Herangehensweise in anderen Ländern Europas [4], hat sich der Strategische Konzerneinkauf der ÖBB dafür entschieden, eine Produkt- bzw. Dienstleistungsbezogene spezifische Berechnung der Umweltwirkungen durchzuführen.
Das TCO CO2 Modell benötigt für eine derart detailliert gewünschte Berechnung, die eine vergleichbare Bewertung der unterschiedlichen Gebote verschiedener Lieferanten zulässt, entsprechende Eingangsdaten aus Zertifikaten oder durch Primär- daten. Diese müssen eine erforderliche Detailtiefe vorweisen, um den Lebenszyklus in der erforderten Qualität abbilden zu können. Die ÖBB haben sich auf Treibhausgasemissionen in Form von CO2-Äquivalenten (CO2e) nach im Kyoto-Protokoll definierten Regularien entschieden. Im Gegensatz zu anderen Umweltfaktoren liegen diese bereits jetzt weltweit ausreichend vor, sind transparent, objektiv und vergleichbar. Das entwickelte Modell erlaubt später das Ergänzen dieser anderen Umweltfaktoren, wie z.B. Feinstaub, Wasser- oder Flächenverbrauch, usw. In der ersten Version des TCO CO2 Modells wurden die End-Of-Life Szenarien (Verschrottung, Verwertung, Weiterverwendung) nicht berücksichtigt. Mittlerweile sind hier die Anforderungen der Kreislaufwirtschaft gestiegen und das Modell wurde nun mit dem Wiederverwertung- spotential als Phase 4 erweitert, wie in Abb 1 zu sehen.
Das Modell verlangt vergleichbare Eingangsdaten, nämlich die Materialien und Prozesse, um mittels vorhandener Emissions- faktoren aus diesen die Emissionen je Phase berechnen zu können. Unter Prozessen verstehen wir entweder Transportprozesse, bei denen Zwischen- oder finale Produkte von A nach B trans- portiert werden, Nutzungsprozesse der Anwendungsphase sowie die Verarbeitungsprozesse, bei denen unter Energieverbrauch aus Eingangsmaterialien ein Zwischen- oder Endprodukt entsteht oder (auf-)gebaut wird. In all diesen Schritten kann CO2 direkt oder indirekt (durch den Energieverbrauch) entstehen und wird in der
Stoffflussbilanz dargestellt. Abb 2 zeigt dies schematisch am Beispiel des Lebenszyklus eines Laptops.
Das vorliegende TCO CO2 Modell kann von privaten als auch öffentlichen Auftraggebern genutzt werden. Alle Erfordernisse wurden berücksichtigt, u.a. die notwendige Transparenz in der Berechnung, als auch das Nutzen frei verfügbarer Emissionsfaktoren. Dazu werden insbesondere die öffentlich zugänglichen Daten der Umweltbundesämter Österreichs und vor allem Deutschlands verwendet. Ein Nebeneffekt sind die fehlenden Kosten für die Nutzung dieser wissenschaftlichen Datensätze.
Spezifisch für die jeweilige Beschaffung lässt sich somit im aus- gesandten, und von den Bietern zu befüllenden, TCO CO2 Tool eine integrierte Datenbank an notwendigen Emissionsfaktoren zur Verfügung stellen. Der Bieter kann die enthaltenen Werte überprüfen und anwenden oder aber ergänzen und mit eigenen Zertifikaten die Anwendung seiner eigenen Emissionsfaktoren in der Berechnung verifiziert nutzbar machen. Damit haben Unternehmen jederzeit die Möglichkeit ihre ökologisch relevanten Innovationen bzw. Investitionen in der Produktentstehung oder Dienstleistungsab- wicklung einfließen zu lassen und letztendlich davon zu profitieren. Beispielsweise kann so ein Bieter, der sein Aluminium aus einer regionalen Recyclingeinrichtung bezieht, die ihren Strom aus Wasserkraft gewinnt, einen ganz anderen Emissionsfaktor für das Aus- gangsmaterial in Anwendung bringen, als ein anderer Bieter, der sein Aluminium aus dem fernen Ausland, mit Kohlestrom aufbere- itet und per Schiff antransportieren lässt.
Auftraggeberseitig sind neben den Standard-Emissionsfaktoren für Prozesse und Materialien ebenso Informationen bereitzustellen, die wir als Parameter der LCC-Betrachtung bezeichnen. Darunter fallen die genaue Beschreibung des zu betrachtenden Produktes bzw. der Dienstleistung, der Anlieferort für die Berechnung der Transportkosten und -emissionen, gewünschte Arbeiten (z.B. Aufbau) vor Ort, die Nutzungsangaben, z.B. wie viele Stunden pro Jahr und unter welchen Bedingungen wird ein Gerät genutzt werden und schließlich die gewünschte Behandlung zum Lebensende. Sind zur Auftragsvergabe manche Parameter unbekannt, so kann man diese auch weglassen und der korrespondierende Anteil der Emissions- betrachtung entfällt. Z.B., wenn man einen Rahmenvertrag über Büromöbel abschließt, für Filialen seiner Firma in ganz Europa, kann es sein, dass man zu diesem Zeitpunkt nicht genau beziffern kann, wie viele Möbel werden wann abgerufen und zu welcher Fil- iale werden diese geliefert. Für die ÖBB wäre eine Bewertung der Transportemissionen in diesem Fall vergaberechtlich nicht zulässig, da hier nur spekuliert werden kann. Hinterliegt hier allerdings ein sauberer Lieferplan, der auch eingehalten werden soll, dann kann man diese Emissionen selbstverständlich bereits in der Angebotsbe- wertung berücksichtigen. Private Unternehmen haben hier weniger Einschränkungen.
Das aktuell noch auf Excel basierende Tool ist branchenunabhängig einsetzbar, wird vom Strategischen Konzerneinkauf der ÖBB zentral verwaltet, fortwährend optimiert und erweitert, um jederzeit der Gesetzgebung und den Anforderungen von Seiten des Auftraggebers und der Bieter zu genügen.
Ein Kniff für den Anwender des TCO CO2 Tools: Verschiedene Szenarien der Produktentstehung oder Dienstleistungsabwicklung sind durchspielbar, um somit Strategien für die eigene Firmenentwicklung ableiten zu können, z.B. Transportmittel ändern, Material austauschen, Energieversorger wechseln, etc. Der Kosten-Nutzen Vergleich ist somit direkt sichtbar.